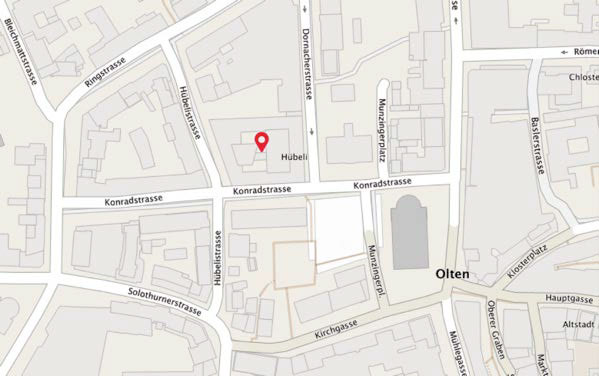Nachdem der Stadtrat im November 2006 die erste Vorlage zur Besoldungsrevision auf Grund von Rückmeldungen im Gemeindeparlament zurückgezogen hat, wurden in der Zwischenzeit insbesondere die Lohnsummenentwicklung, die Regelungen für die
Überführung und die Bewertung der Führungsmerkmale überarbeitet; zudem wurden die „Ausschläge“ von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften begrenzt. Dadurch konnten die Gesamtkosten der neuen Vorlage gegenüber der vorhergehenden in etwa halbiert werden. Bestandteil ist erneut die Einführung einer Leistungskomponente.
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Bericht und Antrag
1. Ausgangslage
1.1 Bedarf nach einer Besoldungsrevision
Seit der letzten Besoldungsrevision in der Stadtverwaltung Olten von 1989/90 haben wesentliche Entwicklungen stattgefunden. Hinzuweisen wäre auf generelle Verschiebungen zu höheren Qualifikationen im administrativen und vielfach auch im technischen Bereich, auf die Einführung neuer Technologien im Informatik- und Internetbereich und auf die Einführung von neuen Hierarchieformen mit entsprechenden Verlagerungen von Verantwortungen etc.
Hinzu kommt, dass in Olten eine Neustrukturierung der Stadtverwaltung stattgefunden hat: Als Resultat der vom Volk deutlich angenommenen Volksinitiative mit dem Titel „5 Stadträte sind genug“ wurde die Zahl der Stadtratsmitglieder reduziert und parallel dazu die Stadtverwaltung neu in sechs Direktionen umstrukturiert. Das Resultat ist mit Beginn der neuen Legislaturperiode 2005-2009 Mitte 2005 in Kraft getreten. Die Zusammenlegung von zwei Direktionen sowie Verschiebungen zwischen einzelnen Direktionen und nachfolgende Überprüfungen hatten Veränderungen in den Aufgabengebieten von betroffenen Personen zur Folge. Gerade diese Neustrukturierung hat die vom Personal wie auch von der Führung seit längerer Zeit gewünschte Besoldungsrevision verzögert: Es ist aber nachvollziehbar, dass erst die Resultate der Neustrukturierung abgewartet werden mussten, bevor die Arbeitsplätze neu bewertet und die Besoldungen entsprechend angepasst werden konnten.
Nicht nur was die Neueinreihung der verschiedenen Funktionen betrifft, besteht Handlungs-bedarf: Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das heutige, punkto Lohnentwicklung auf reinen Automatismen beruhende Lohnsystem durch eines zu ersetzen, bei dem in einem moderaten Ausmass auf der Basis der Zielvereinbarungen die individuelle Leistung einen Einfluss auf den Lohn und die Lohnentwicklung hat. Dies entspricht auch der Zielsetzung eines bereits 1995 vom Gemeindeparlament überwiesenen Postulates von Beat Moser (FdP), in dem nach einer verstärkten Leistungsorientierung gerufen wurde. Ein neues Lohnsystem soll zudem künftig Lohnentwicklungen auch in späteren Berufsjahren ermöglichen, während sich heute auf Grund des raschen Aufstiegs rund 80% der Mitarbeitenden im Lohnmaximum befinden und ihr Gehalt entsprechend nicht von einer Leistungskomponente beeinflusst werden könnte.
1.2 Vorlage BesArbOl 1
Knapp zwei Jahrzehnte nach der letzten Besoldungsrevision in der Stadtverwaltung Olten ist in den Jahren 2005 und 2006 von einer paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen zusammengesetzten Projektgruppe ein neues, mit einer Leistungskomponente versehenes Lohnsystem ausgearbeitet worden; gleichzeitig wurden auch alle Stellen auf der Basis des Systems Abakaba unter Anleitung des externen Experten Christian Katz (Cham) neu eingestuft. Die beantragte Überführung sah Mehrkosten im ersten Jahr von rund 1,5% der aktuellen Lohnsumme vor; hinzu kamen Anpassungen bei den Zulagen und bei den Stundenlohnansätzen. Während im bisherigen Lohnsystem automatisch innert maximal zehn Jahren vom Lohnminimum zum -maximum geklettert werden konnte, sah das neue System vor, dass dies künftig bei guten Leistungen durchschnittlich 30 Jahre dauern würde und das Erreichen des Lohnmaximums nicht mehr garantiert wäre.
Die entsprechende Vorlage wurde dem Parlament am 22. November 2006 zur Genehmigung vorgelegt. In der Debatte wurde die geleistete Arbeit ausdrücklich gewürdigt und dem neuen System zugestanden, dass es für mehr Transparenz, Lohngleichheit und Lohngerechtigkeit sorge. Mehrheitlich begrüsst wurde auch die Leistungskomponente. Kritisiert wurden insbesondere die Kosten des neuen Systems. Bürgerliche Parteien riefen im Gegensatz zum stadträtlichen Antrag nach Kostenneutralität und kritisierten weiterhin bestehende Automatismen. Ins Kreuzfeuer allgemeiner Kritik kamen auch die bisherige Familienzulage und die Besitzstandsregelung, wonach die gegenwärtigen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber auch bei einer Tiefereinstufung ihrer Funktion ihren bisherigen Lohn bis zum Ausscheiden aus dem Dienst der Stadtverwaltung weiterhin erhalten sollten. Der Stadtrat zog daraufhin die Vorlage zur Überarbeitung zurück, da es angesichts der erforderlichen Volksabstimmung eine klare Zustimmung des Parlaments zur Vorlage gebraucht hätte.
1.3 Vorarbeiten für Überarbeitung
Angesichts der verschiedenartigen, sich teilweise stark widersprechenden Signale aus dem Parlament legte das Stadtpräsidium als zuständige Direktion nach dem Rückzug folgenden, vom Stadtrat anschliessend abgesegneten Zwischenschritt fest: Je ein/e Personalchef/in aus der Privatwirtschaft sowie von einer vergleichbaren Stadt sollten gebeten werden, einschätzende Aussagen zum erarbeiteten Einreihungsplan und zum neuen Lohnsystem zu machen. Auf dieser Basis sollte das weitere Vorgehen definiert und sollten anschliessend die Fraktionen zu den vorgesehenen Schritten begrüsst werden.
Die Gespräche mit den beiden Personalfachleuten fanden am 25. und 26. Januar 2007 statt. Stadtpräsident Ernst Zingg und Projektleiter Markus Dietler begrüssten dabei Judith Dali, Leiterin Corporate HR Atel AG, und Gaston Barth, Personalchef und Rechtskonsulent der Stadt Solothurn. Dabei wurde das erarbeitete System im Allgemeinen von beiden Fachleuten als gut geeignet für die Zwecke der Stadtverwaltung Olten beurteilt.
Judith Dali schickte voraus, eine Besoldungsrevision sei kaum kostenneutral durchzuführen. Das von Olten gewählte System sei – im Gegensatz zu solchen der Privatwirtschaft, die aber im Handling viel aufwändiger seien – sehr berechenbar und transparent; die hohe Analytik und die hohe Transparenz hätten aber ihren Preis. Sie machte darauf aufmerksam, dass mit einem Systemwechsel auch kulturelle Aspekte verbunden seien, die nicht unterschätzt werden dürften. Zum Thema Besitzstand vertrat sie die Ansicht, wenn die Anzahl der Besitzstände in einem vernünftigen Mass stünden, würde sie diese aus Motivationsgründen wahren. Sie war ferner der Meinung, ein Einbezug einer externen Fachkraft in der Einstufungskommission hätte nicht viel gebracht, da ein Einblick in kurzer Zeit nicht möglich sei und Vergleiche oft hinkten. Nicht einmal in der gleichen Branche seien Quervergleiche oder Faustregeln etwa für das Verhältnis zwischen tiefstem und höchstem Lohn einfach.
Gaston Barth rühmte die geleistete Arbeit und bezeichnete den beigezogenen Experten als anerkannt. Das neue Lohnsystem stelle einen guten Kompromiss dar, um Leistung anzuerkennen. Er begrüsste ferner die Möglichkeit, neue Perspektiven zu schaffen für Personen, die heute im Maximallohn seien, was aber mit Mehrkosten verbunden sei. Den neuen Lohnraster bezeichnete er als „nicht revolutionär“, die Lohnklassen als mit Solothurn vergleichbar; in den oberen Lohnklassen zahle Solothurn sogar etwas besser. Auch die geplante Überführung stelle keine Luxuslösung dar. Handlungsspielraum sah er im Bereich Überführung bei der Besitzstandsdauer sowie im Bereich des Lohnsystems darin, dass anstelle der reglementarisch festgelegten jährlichen Lohnsummenerhöhung um 1,5% die aufgrund des Systems und der Qualifikationen erforderlichen reellen Lohnerhöhungen budgetiert würden.
Die Stabsmitarbeiter des Stadtpräsidiums, unterstützt durch Finanzverwalter Peter Kohler, situierten nach einer Diskussion mit dem externen Experten der ersten Vorlage in der Folge den möglichen Handlungsspielraum in folgenden Bereichen:
- Lohnsummenentwicklung
- Überführung/Besitzstand
- Begrenzung der „Ausschläge“ von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften
An seiner Sitzung vom 12. März 2007 legte der Stadtrat fest, dass die erwähnten Punkte überarbeitet werden sollten. Dabei sollte sowohl eine Variante mit und ohne Begrenzung der „Ausschläge“ studiert werden. Zudem sollte auch geprüft werden, wie die Tatsache berücksichtigt werden könnte, dass die Mitglieder der Direktionskonferenz im Gegensatz zur übrigen Belegschaft ihre Arbeitszeit nicht erfassen und damit keine Abgeltung für Überstunden erhalten. Punkto Familienzulage legte der Stadtrat fest, dass diese zwar aus der gegenwärtigen Vorlage ausgeklammert, innert einer festgelegten Frist aber überarbeitet werden sollte. Für die Teuerung sah er einen Ausgleich gemäss Index vor. Er gab zudem den Auftrag, für das Merkmal Führung eine Alternative zum Abakaba-Ansatz der „vollständigen Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der direkt und indirekt unterstellten Personen“ zu prüfen.
1.4 Einbezug der Fraktionen
Am 26. März 2007 wurden diese neuen Vorgaben den Fraktionspräsidien im Sinne eines ersten Feedbacks zu den geplanten Veränderungen der ursprünglichen Parlamentsvorlage unterbreitet. Angesichts der kontroversen Diskussion im Parlament hat der Stadtrat dieses Vorgehen auf der Basis von konkreten Vorschlägen der von der CVP-Fraktion angeregten Einsetzung einer Spezialkommission vorgezogen. Die anwesenden Fraktionspräsidien bezeichneten die aufgezeigten Möglichkeiten als interessant und lobten, dass nun verschiedene Szenarien vorlägen. Sie einigten sich darauf, dass möglichst rasch alle Parlamentsmitglieder informiert werden sollten, so dass anschliessend die Fraktionen über die Vorschläge beraten könnten.
Diese Information und die anschliessenden Fraktionssitzungen wurden am 10. April 2007 durchgeführt. Mehrheitlich ertönte in den nachfolgenden Stellungnahmen der Ruf nach deutlichen Minderkosten gegenüber der ersten Vorlage im Sinne einer Begrenzung der „Ausschläge“ von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften, nach einer Begrenzung des Besitzstandes und nach einer möglichst raschen neuen Lösung für die Familienzulage; der Teuerungsausgleich solle weiterhin in der Kompetenz des Parlaments bleiben.
1.5 Definitive Vorgaben für Überarbeitung
Der Stadtrat entschied daraufhin an seiner Sitzung vom 23. April 2007, dem Parlament eine Vorlage mit folgenden Parametern zu unterbreiten:
- Generell deutliche Reduktion der (End-)Kosten
- Begrenzung der „Ausschläge“ von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften
- Neuer Ansatz mit gewichteter Führung
- Besitzstand während 5 Jahren
- Teuerungsausgleich: Variantenvorlage Ausgleich gemäss Index vs. Parlamentshoheit
- Familienzulage: Neuausrichtung mit maximal identischen Kosten innert 3 Jahren
- „Erben“ des Überführungsniveaus bei Neueinstellungen
2. BesArbOl 2
Die folgenden Ausführungen beschränken sich im Wesentlichen auf die erwähnten Änderungen gegenüber der ersten Vorlage ans Gemeindeparlament im November 2006; die Beschreibung befindet sich in der Beilage .
2.1 Lohnsummenentwicklung
Damit das vorgesehene leistungsabhängige Lohnsystem umgesetzt werden kann, werden in den Jahren 2009 bis 2017 degressiv abgestufte Maximalwerte zwischen brutto 1,25% und 0,9% der Lohnsumme eingesetzt, die anteilsmässig auf die Direktionen verteilt werden. Ab 2018 entstehen keine Mehrkosten mehr. Diese Reduktionsmöglichkeit ist auf verschiedene Massnahmen zurückzuführen:
- Weiterentwicklung nach für jede Funktion definierter Altersbasis (statt Position im Lohnband)
- Maximale statt durchschnittliche Erhöhungen
- Neue Besitzstandsregelung
- „Erben“ von Positionen
2.1.1 Weiterentwicklung nach Altersbasis
Entscheidend für die Lohnsummenentwicklung sind neu die anrechenbaren Jahre ab für jede Funktion definierter Altersbasis. Das heisst, die individuelle Lohnentwicklung ist gegliedert auf die ersten acht Jahre, die nächsten zwölf Jahre und die folgenden bis zur Erreichung des Maximallohns und richtet sich nicht mehr nach der (prozentualen) Position im Lohnband. Dies führt zu einem grösseren Einfluss der Qualifikation und des Leistungslohns auf die Lohnhöhe und gilt auch für die Überführung, wo die Weiterentwicklung nach Altersbasis Minderkosten bewirkt.
BesArbOl 1
Position im Lohnband Durchschnittliche Erhöhung bei Beurteilung genügend in % Durchschnittliche Erhöhung bei Beurteilung gut in % Durchschnittliche Erhöhung bei Beurteilung hervorragend in % Jahre, bis Position im Lohnband erreicht ist (Durchschnitt)
100%-120% 2.5(garantiert) 2.5(garantiert) 3.5 8
120%-138% 0.5 1.5 3 12
138%-150% 0 1.2 2.5 10
BesArbOl 2
Anrechenbare Jahre Max. Erhöhung bei Beurteilung genügend in % Max. Erhöhung bei Beurteilung gut in % Max. Erhöhung bei Beurteilung hervorragend in %
1 bis 8 2.5(garantiert) 2.5(garantiert) 3.5
9 bis 20* 0.5 1.5 3
Folgende* 0 1.2 2.5
*sofern Maximallohn von 150% noch nicht erreicht
Beispiel: Eine 41jährige Person mit Altersbasis 20 Jahre, die bei Überführung auf 124% im Lohnband landet, erhält nicht (gemäss BesArbOl 1) 1,5% für gute Leistung bzw. 0,5% bei genügender Leistung im Lohnband zwischen 120 und 138%, sondern (gemäss BesArbOl 2) bei 21 anrechenbaren Jahren 1,2% bei guter und 0% bei genügender Leistung.
2.1.2 Maximale statt durchschnittliche Erhöhungen
Die leistungsabhängigen Lohnerhöhungen erfolgen nicht mehr in durchschnittlichen, sondern in Maximalansätzen. Das bedeutet, dass die gesamte Lohnsummenerhöhung nicht mehr wie in der Vorlage BesArbOl 1 vollständig ausgeschöpft und verteilt wird (wodurch die Erhöhungen je nach Konstellation auch überdurchschnittlich hätten ausfallen können), sondern auf Grund der Verteilung nach effektiv erfolgten Leistungsbeurteilungen durchaus auch unter dem angesetzten Maximum liegen kann.
2.2 Überführung
2.2.1 Neue Besitzstandsregelung
Während in der Vorlage BesArbOl 1 eine individuelle Besitzstandsgarantie auf dem Jahreslohn (exkl. Zulagen) postuliert worden war, beantragt der Stadtrat nun auf Grund der Reaktionen im Parlament eine Reduktion der Dauer des Besitzstandes oberhalb des Maximallohns gemäss neuem Einreihungsplan auf fünf Jahre. Anschliessend wird der Lohn der oder des Betreffenden auf den Maximallohn seiner Lohnklasse mit Anrechnung eines allfälligen in der Zwischenzeit erfolgten Teuerungsausgleichs reduziert. Allfällige noch bis zur vorgesehenen Einführung des neuen Lohnsystems erfolgende Änderungen im Einreihungsplan (z.B. als Folge der Neuausrichtung Direktion Öffentliche Sicherheit) gegenüber der aktuellen Vorlage begründen keinen Besitzstand.
2.2.2 „Erben“ von Positionen
Im Sinne einer internen Fairness wird bei einer Neuanstellung das Überführungsniveau zur Berechnung des Lohnes der neuen Person herangezogen. Dies nicht nur dort, wo mehrere Personen die gleiche Funktion ausüben, sondern auch bei Einzelpositionen. Somit wird das erreichte Niveau der Überführung vom alten aufs neue Lohnsystem bei Neueinstellungen berücksichtigt.
2.3 Teuerungsausgleich
Anstelle der in BesArbOl 1 geplanten Koppelung des Teuerungsausgleichs für das städtische Personal an das Ergebnis der Lohnverhandlungen auf kantonaler Ebene gemäss Regelung des Gesamtarbeitsvertrags legt der Stadtrat neu zwei Varianten vor:
A. Ausgleich der Teuerung gemäss Landesindex vom November des jeweiligen Vorjahres, wie dies in zahlreichen Gesamtarbeitsverträgen schweizweit geregelt ist: Für diese Variante spricht die Zielsetzung der Kaufkrafterhaltung, um einen Lohnabbau zu verhindern. Hinzu kommt, dass auf diese Weise eine Ungleichbehandlung mit den rund 350 Lehrkräften, die dem kantonalen GAV unterstehen und einen Ausgleich gemäss im GAV geregeltem Verhandlungsergebnis erhalten, vermieden oder zumindest reduziert werden könnte. Eine ähnliche Lösung gilt im Übrigen auch für das Bundespersonal, wo ebenfalls nicht die Legislative über einen Teuerungsausgleich entscheidet. Über allfällige Reallohnanpassungen würde indessen weiterhin das Gemeindeparlament abschliessend entscheiden.
B. in Berücksichtigung der Eingaben aus den Fraktionssitzungen vom 10. April 2007 Delegation des jährlichen Entscheides über einen allfälligen Teuerungsausgleich – wie auch über allfällige Reallohnanpassungen – abschliessend ans Parlament.
2.4 Familienzulage
Für die Familienzulage bezugsberechtigt sind derzeit 61% des städtischen Personals; die Gesamtsumme beträgt CHF 431'000. Die Streichung dieser Zulage (derzeit CHF 320.80 monatlich für ein 100%-Pensum) würde für die Betroffenen ein Ausfall eines grossen Bestandteils des heutigen Lohnes bedeuten. Besitzstandsregelung und Veränderungen bei den Zulagen führen in Kombination mit einer Abschaffung der Familienzulage zudem in Einzelfällen zu einer Kumulation von negativen Veränderungen. Entsprechend wären auch Lohnklagen gegen die Abschaffung dieser als Lohnbestandteil betrachteten Zulage zu erwarten. Würde die heutige Zulage – wie dies bei der Abschaffung auf Kantonsebene der Fall war – in die Gesamtlohnsumme eingebaut, würde es zu einer wenig sozialen Lösung kommen, da die mehr Verdienenden grössere und die weniger Verdienenden kleinere Anteile erhielten. Zudem würde ein einmaliger Einkauf in die Pensionskasse (rund Fr. 600'000) anfallen; dies auch auf Seiten der Arbeitnehmenden, die dadurch unter dem Strich teils weniger Geld ausbezahlt erhalten könnten. Eine Streichung für neue Mitarbeitende und eine Besitzstandsregelung für bisherige Mitarbeitende ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, da es sonst zu einer Ungleichbehandlung zwischen neuen und bisherigen Mitarbeitenden kommen würde. Um die Vorlage der Besoldungsrevision nicht zusätzlich zu belasten und zu verzögern, beantragt der Stadtrat deshalb, die bisherige Regelung einstweilen beizubehalten; das Parlament soll ihn aber beauftragen, innert 3 Jahren eine Vorlage für eine Neuausrichtung der Familienzulage zu unterbreiten (z.B. Umwandlung in Betreuungszulage, für alle identischer Einbau in Lohn, Verwendung als Leistungsbonus, Umwandlung in zusätzlichen Ferienanspruch etc.), deren Gesamtkosten diejenige der Familienzulage nicht überschreiten dürfen.
2.5 Änderung Einreihungsplan durch Neudefinition Führungsmerkmal
Der Fragebogen gemäss Abakaba ging bei der Linienführung von der „vollständigen Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der direkt und indirekt unterstellten Personen“ aus, ungeachtet der Führungsstruktur des jeweiligen Bereiches und der Hierarchiestufe. Im Auftrag des Stadtrates wurde bei der Überarbeitung zuerst eine Berücksichtigung der direkten Führung mit Qualifikation geprüft, dann aber auf Empfehlung des externen Experten nach einer Möglichkeit gesucht, für einen allfälligen Systemwechsel die je nach Führungsebene qualitativen Unterschiede in der Verantwortung zu berücksichtigen.
Das nun gewählte System beinhaltet, dass das Merkmal der Linienführung mit einer für alle Führenden gleichen Punktezahl abgegolten wird, hingegen unterschiedliche Punktezahlen für die verschiedenen Ebenen – wie Gruppen, Abteilung, Verwaltungsleitung, Vorsitz Verwaltungsleitung, alleinige Verwaltungsleitung etc. – verliehen werden. Abteilungsleitende, die zugleich Mitglieder einer Verwaltungsleitung sind, erhalten dabei für ihre Mitverantwortung zusätzliche Punkte; parallel dazu erhalten die Verwaltungsleitenden, welche die Alleinverantwortung tragen, auch mehr Punkte als die Vorsitzenden von mehrköpfigen Verwaltungsleitungen. Die Tatsache, dass die Mitglieder der Direktionskonferenz (Vorsitzende der Verwaltungsleitungen, alleinige Verwaltungsleitende sowie Rechtskonsulent/in, Controller/in und Leiter/in Personaldienst) ihre Arbeitszeit nicht erfassen und daher für Überstunden auch nicht entschädigt werden, wird mit zusätzlichen Punkten teilweise berücksichtigt.
Die neue Gewichtung der Führung hat zahlreiche Vorteile: Sie geht auf die Verantwortung der betreffenden Funktionen und Personen ein, ist unabhängig von den heterogenen Führungsverhältnissen in der Stadtverwaltung mit zum Teil schwer anzurechnenden Führungsverhältnissen (z.B. Zivilschutz, Feuerwehr oder Reinigungspersonal), von Zu- und Abgängen und provisorischen Stellen und beinhaltet keine (eher) willkürlichen Quantitätskategorien von geführten Personen. Sie wirkt zudem eher kostendämpfend, da einerseits einzelne grosse Gewinner aus BesArbOl 1 leicht sinken, anderseits Besitzstände reduziert werden, was keine Mehrkosten bewirkt.
2.6 Variante BesArbOl 2 mini: Begrenzung der Ausschläge von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften
Um auf die Einwände an der Parlamentssitzung vom vergangenen November betreffend (End-)Kosten für die Besoldungsrevision zu reagieren, soll neu zusätzlich zu den beschriebenen Massnahmen die „Amplitude“ der Ausschläge von Mehr- oder Minderlohnanwart-schaften beschränkt werden. Dabei werden die durch das System Abakaba erfolgten Empfehlungen zwar berücksichtigt, aber in einem reduzierten Mass. Dies führt zu einem kompakteren Lohngefüge, in dem der jeweilige Sollzustand rascher erreicht werden kann und auch die Höhe des Besitzstandes reduziert wird. Somit pendelt sich das System rascher ein.
Konkret wird folgendes Vorgehen vorgesehen:
- Maximallohn heute tiefer als Maximallohn gemäss Abakaba (BesArbOl 2): Das Lohnmaximum nach altem System wird analog dem neuen individuellen Lohnband auf 150% berechnet. Von der Differenz zwischen diesen 150% und dem Maximum gemäss Abakaba wird ein definierter Prozentsatz für das neue Maximum nach Bes-ArbOl mini berücksichtigt. Das Resultat wird gemäss dem neuen Maximallohn in eine entsprechende Lohnklasse eingereiht; üben mehrere Personen die gleiche Funktion aus, wird die zutreffende Lohnklasse über die Mehrheit definiert.
- Maximallohn heute höher als Maximallohn gemäss Abakaba (BesArbOl 2): Von der Differenz zwischen dem Lohnmaximum nach altem System und dem Maximum gemäss Abakaba wird ein definierter Prozentsatz für das neue Maximum nach BesArb-Ol mini berücksichtigt. Das Resultat wird gemäss dem neuen Maximallohn in die entsprechende Lohnklasse eingereiht; üben mehrere Personen die gleiche Funktion aus, wird die zutreffende Lohnklasse über die Mehrheit definiert.
Um zu verhindern, dass zahlreiche Funktionen in unteren Lohnklassen wegen der „Mini-Version“ tiefer eingereiht werden müssen, wird unterhalb der Lohnklasse 15 ein Satz von 75% gewährt, ab der Lohnklasse 15 – das heisst ab einem Funktionslohn von 70'000 Franken, wo schwergewichtig Führungsfunktionen wahrgenommen werden – ein Satz von 50%. Damit werden in einem weiteren Punkt die tieferen Lohnklassen im Vergleich bevorzugt behandelt, nachdem bereits der Frankenbetrag pro Abakaba-Punkt bei den unteren Lohnklassen höher liegt als bei den oberen (konkret bewegen sich die Beträge pro Punkt zwischen 512 und 258 Franken, das heisst in der untersten belegten Lohnklasse erhält man ziemlich genau doppelt so viele Franken pro Punkt wie in der obersten Lohnklasse).
2.7 Zulagen
Anlässlich der Besoldungsrevision stellt sich auch die Frage, welche lohnbestimmenden Faktoren bereits im Grundlohn abgebildet werden und welche mit Zulagen abzudecken sind. Zielsetzung der Projektgruppe war – nicht zuletzt im Sinne einer Bereinigung des unübersichtlichen bisherigen Zulagensystems – eine Vereinheitlichung und eine Gleichbehandlung über die gesamte Stadtverwaltung hinweg.
- Wochenend- und Nachtarbeit:
Als Arbeitszeitrahmen wurde die Zeit zwischen Montag bis Freitag von 0600 und 2000 Uhr festgelegt. Die Wochenendarbeit (Samstag und Sonntag sowie arbeitsfreie Feiertagen zwischen 0600 und 2000 Uhr) wird neu mit einem einheitlichen Zuschlag von Fr. 12.- pro Stunde entschädigt, da die Belastung für alle Mitarbeitenden unabhängig von ihrer Funktion (die mit dem Grundlohn abgegolten wird) identisch ist. Die Nachtarbeit zwischen 2000 und 0600 Uhr wird mit einem Zuschlag von Fr. 12.- pro Stunde entschädigt. Zwischen 2300 und 0600 Uhr wird zusätzlich ein Zeitzuschlag von 10% ausgerichtet.
Die Angehörigen der Stadtpolizei erhalten gemäss einer in der Zwischenzeit seit der ersten Vorlage zur Besoldungsrevision erarbeiteten Regelung (Stadtratsprotokoll 373 vom 18. Dezember 2006) für die Wochenend- und Nachtarbeit eine Pauschale von Fr. 2000.- pro Jahr sowie einen Zuschlag von Fr. 9.70 pro geleistete Stunde.
Die Inkonvenienzen der Hauswarte der Schulanlagen werden nach dem geltenden Dienstreglement für haupt- und nebenamtliche Hauswarte von Schulanlagen und Kindergartenanlagen vom 1. Juli 1994 entschädigt.
Die Pikettbereitschaft im Werkhof (Winterdienst) und bei der Informatik wird mit einer Zulage von Fr. 19.- pro Tag entschädigt. Für die Bereitschaftszeit der Stadtpolizei wird gemäss oben genannter Neuregelung seit 1. Januar 2007 eine Entschädigung von 17.65 Franken pro Stunde ausgerichtet.
- Telefonentschädigungen/Fahrradentschädigungen:
Verschiedene Telefonentschädigungen sowie die Fahrradentschädigungen bei der Polizei werden aufgehoben. Allfällige Kommunikationsspesen, die nicht in der Pikettbereitschaft enthalten sind, werden gemäss Reglement über die Ausrichtung von Entschädigungen für Verwaltungsangehörige (SRO 132) geregelt.
- Beladen/WC-Reinigung/Hausräumungen:
Die bisherigen Zulagen für Beladen, WC-Reinigung und Hausräumungen im Werkhof werden beibehalten, sofern diese Aufgaben nicht bei ständiger Ausübung in der jeweiligen Funktionsbewertung berücksichtigt sind.
- Ausbildung von Lernenden:
Für die Ausbildung von Lernenden wird eine Zulage von Fr. 200.- pro Monat ausbezahlt, sofern die Ausbildenden sonst keine Führung ausüben.
Diese bisher im Werkhof ausgerichtete Zulage wird als nicht mehr notwendig erachtet und aufgehoben. Auf die Ausrichtung von Zulagen für Stellvertretungen in Abwesenheit der vorgesetzten Person wird generell verzichtet, da dafür meist eine erfahrene Person ausgewählt wird, die auf Grund ihrer Erfahrung im individuellen Lohnband ohnehin hoch eingestuft sein dürfte; übernimmt hingegen die Stellvertretung das ganze Jahr über fest zugeteilte Aufgaben, wird dies im Abakaba-System abgebildet. Bei länger dauernden Stellvertretungen in Form einer längerfristigen Übernahme von Aufgaben z.B. im Krankheitsfall eines bzw. einer Vorgesetzten kann der Stadtrat wie bisher Funktionszulagen gewähren.
Durch die einheitliche Regelung von Wochenend- und Nachtarbeit und damit den Einbezug von bisher nicht berücksichtigten Funktionen (Badmeister, Sportanlagenwarte, Bibliotheksangestellte), kommt es zu Mehrkosten , während sich für die übrigen Zulagen die Mehr- und Minderkosten die Waage halten.
3. Teilrevision Art. 22ff. Personalreglement
Im Personalreglement vom 15. November 2001 wurden in Art. 22 das Lohnsystem und die Besoldung definiert (parallel dazu auch in Art. 18 Personalverordnung). Dabei wurden bis zu einer Überprüfung der Einreihung der Mitarbeitenden das geltende Besoldungskonzept und die Gehaltsskala mit den derzeitigen Einstufungen sowie die entsprechenden Bestimmungen der Arbeits- und Gehaltsordnung vom 6. Juni 1990/12. Mai 1993 vollumfänglich übernommen. Mit einer Teilrevision des Personalreglements durch das Gemeindeparlament (und analog der Personalverordnung durch den Stadtrat) wird diese Regelung abgelöst.
Die einzelnen Bestimmungen werden wie folgt kommentiert:
Art. 22
Abs. 1
Hier wird aus Art. 56 AGO der Anspruch der Mitarbeitenden auf die in Reglement und Verordnung vorgesehenen Besoldungen und Zulagen übernommen.
Art. 22a
Die Zuordnung neuer Funktionen oder die Neuzuordnung bestehender Funktionen zu Lohnklassen basiert grundsätzlich auf dem Abakaba-System; die gemeindeintern abschliessende Kompetenz liegt weiterhin beim Stadtrat. Durch diesen Artikel ersetzt werden Art. 43 bis 45 AGO. Art. 53 und 54 AGO erübrigen sich, da keine lohnwirksamen Beförderungen ohne Funktionswechsel vorgesehen sind. Entsprechend sind auch die Beförderungsrichtlinien der Stadtpolizei zu überarbeiten.
Art. 22b
Abs. 1
Die Unterteilung nach Führungs- und Fachfunktionen (Art. 22 Abs. 2 PR) wird durch die Bemessung auf Grund der vier Kriterien intellektuelle, psychosoziale, physische und Führungsanforderungen und Belastungen ersetzt. Diese ersetzt zudem die entsprechenden Bestimmungen in Art. 42 AGO.
Abs. 2
Das Lohnsystem umfasst neu 34 (statt 29) Lohnklassen und einen Unterschied zwischen Funktionslohn und Maximallohn von 50 (statt 40) %. Dadurch bleiben mehr individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich Lohn auch in späteren Berufsjahren; die Frist, innerhalb derer von der Altersbasis ausgehend der Maximallohn erreicht werden kann, wird indessen von heute 10 auf mindestens 30 Jahre (bei guten Leistungen) erhöht.
Abs. 3
Der bisherige automatische Stufenanstieg über das ganze individuelle Lohnband hinweg (Art. 48 und 49 AGO) wird ersetzt durch einen garantierten Lohnanstieg in den ersten 8 Jahren ab Altersbasis (nicht zu verwechseln mit dem Stellenantritt bei der Stadtverwaltung!) und eine leistungsabhängige Lohnentwicklung in den Folgejahren, welche an die Stelle der bisherigen Anerkennungszulage (Art. 51 AGO) tritt. Dies bedingt eine regelmässige Leistungsbeurteilung, deren Details in der Personalverordnung geregelt werden (bisher Art. 55 AGO). Damit diese Lohnentwicklung möglich ist, werden in den Jahren 2009 bis 2017 degressiv abgestufte Maximalwerte zwischen brutto 1,25% und 0,9% der Lohnsumme eingesetzt.
Art. 22c
Die Anfangsbesoldung wird wesentlich vom Abakaba-System und von Art. 22b Abs. 3 bestimmt. Abs. 2 regelt analog zu Art. 47 AGO allfällige Ausnahmen. Eine zusätzliche Gewinnungszulage (bisher Art. 50 AGO) ist nicht mehr vorgesehen.
Art. 22d
Anstelle der in der Novembervorlage (BesArbOl 1) vorgesehenen Koppelung des Teuerungsausgleichs für das städtische Personal an das Ergebnis der Lohnverhandlungen auf kantonaler Ebene gemäss Regelung des Gesamtarbeitsvertrags legt der Stadtrat neu zwei Varianten vor:
A. Ausgleich der Teuerung gemäss Landesindex vom November des jeweiligen Vorjahres, wie dies in zahlreichen Gesamtarbeitsverträgen schweizweit geregelt ist: Für diese Variante spricht die Zielsetzung der Kaufkrafterhaltung, um einen Lohnabbau zu verhindern. Hinzu kommt, dass auf diese Weise eine Ungleichbehandlung mit den rund 350 Lehrkräften verhindert werden könnte, die wie das Personal der Kantonsverwaltung dem kantonalen GAV unterstehen und einen Ausgleich gemäss im GAV geregeltem Verhandlungsergebnis erhalten. Auch das Bundespersonal kennt eine ähnliche Regelung, welche die Teuerungsanpassung ebenfalls nicht der Politik überlässt. Über allfällige Reallohnanpassungen würde weiterhin das Parlament entscheiden.
B. In Berücksichtigung der Eingaben aus den Fraktionssitzungen vom 10. April 2007 Delegation des jährlichen Entscheides über einen allfälligen Teuerungsausgleich – wie auch über allfällige Reallohnanpassungen – ans Parlament.
Für die Zulagen wird analog zur bestehenden Regelung eine Anpassung vorgesehen, wenn der Index seit der letzten Anpassung um mehr als 10 Punkte angestiegen ist.
Art. 22e
Dieser Artikel regelt die Handhabung des 13. Monatslohnes analog Art. 56 AGO.
Art. 22f
Dieser Artikel regelt weitere Lohnbestandteile wie Zulagen bei abweichender Arbeitszeit und für Pikettdienst (bisher Art. 60 und 61 AGO), Funktionszulagen (bisher Art. 62 AGO), Sozialzulagen (bisher Art. 58 AGO), Dienstaltersgratifikation und -geschenk (bisher Art. 65 AGO), Austrittsgratifikation und -geschenk (bisher Art. 66 AGO) und Besoldungsnachgenuss (bisher Art. 71 AGO). Die Details werden in der Personalverordnung geregelt.
Art. 22g
Neu wird der Verweis auf das Reglement über die Ausrichtung von Entschädigungen an Verwaltungsangehörige (SRO 132, bisher Art. 18 PV) ins Personalreglement aufgenommen.
Art. 22h
Analog zu Art. 42 AGO wird festgehalten, dass die Besoldung der Stadtratsmitglieder im Reglement über die Ausrichtung von Entschädigungen für Behördentätigkeit (SRO 123) geregelt wird.
Art. 41
In Art. 41 wird die bisherige, teilweise noch gültige Arbeits- und Gehaltsordnung integral aufgehoben. Entsprechend muss auch Art. 43 ersatzlos aufgehoben werden.
4. Lohnvergleiche
Grundsätzliche Überlegungen zum Thema Lohnvergleiche wurden bereits in der Vorlage vom November 2006 angestellt. Zielsetzung muss ein Lohnsystem sein, das im betriebsinternen und -externen Quervergleich als gerecht erachtet wird. Ziel des internen Vergleichs ist eine gleiche Entlöhnung für gleichwertige Tätigkeiten. Mit der ausgewählten, insbesondere auch „geschlechtsneutralen“ analytischen Arbeitsbewertung und der fachgerechten, zeitintensiven Anwendung durch die Projektgruppe unter der Anleitung des externen Experten wird nach Ansicht des Stadtrates dem Erfordernis der betriebsinternen Lohngerechtigkeit Genüge getan.
Das sorgfältige Vorgehen mit einem System, das unternehmensspezifische Merkmals-abänderungen nur in ganz geringem Ausmass zulässt, soll auch mit ein Garant sein, dass nicht einzelne Löhne aus dem Rahmen fallen. Externe Lohnvergleiche hingegen sind mit dem Risiko behaftet, dass – über Regionen und Branchen hinweg – nicht Gleiches mit Gleichem verglichen wird. Dennoch wurden die Minimal- und Maximalwerte der neuen Lohnklassen neben den bisherigen in Olten auch denjenigen verschiedener anderer Gemeinwesen der öffentlichen Hand im Rahmen eines Lohnvergleiches des Zentralverbands Staats- und Gemeindepersonal Schweiz gegenübergestellt. Eingebunden wurden ferner Vergleiche mit Empfehlungen des SKV und mit der Erhebung der orts- und berufsüblichen Mindestlöhne des AWA Aargau sowie mit den Besoldungen in den vergleichbaren Städten Aarau, Burgdorf und Zofingen, die in verdankenswerter Weise ihre Zahlen zur Verfügung gestellt haben. Ebenso wurde der Lohnvergleich von BDO Visura herangezogen.
Im Vergleich zur Novembervorlage hat die Anwendung von BesArbOl 2 mini zur Reduktion von „Ausschlägen“ nach oben und unten geführt.
5. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Der Stadtrat hat schon im Vorfeld der Arbeiten an der Besoldungsrevision erklärt, dass diese nicht kostenneutral ausgeführt werden könne. Entsprechende Mehrkosten wurden denn auch bereits in die Finanzplanung der letzten Jahre aufgenommen. Und auch das Parlament hat dies bestätigt, indem es in der Dezembersitzung 2005 für die Umsetzung der Besoldungsrevision zu Gunsten des städtischen Personals im Budget 2006 anstelle einer Lohnanpassung eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 0,5% der gesamten Lohnsumme des städtischen Personals vornahm.
Eine generelle Kostenneutralität wäre nur zu erreichen, wenn Lohnentwicklungen einzelner nach oben mit parallelen Entwicklungen anderer nach unten kompensiert würden. Würde man – um eine Kostenneutralität zu erzielen – weniger Franken pro Abakaba-Punkt bezahlen oder die errechneten Ansätze generell prozentual nach unten korrigieren, würde die Zahl der Mitarbeitenden im Besitzstand nach oben schnellen und wäre das Prinzip des Leistungslohns nicht mehr umsetzbar, da für noch mehr Mitarbeitende als heute – wo sich 80% der Mitarbeitenden im Lohnmaximum befinden – keine Lohnentwicklung möglich wäre.
5.1 Wiederkehrende Kosten Personal im Jahreslohn
5.1.1 Überführung/erster Schritt
Der Stadtrat hat in der Novembervorlage ein Lohnsummenwachstum für die Überführung von rund 1,5% – oder rund 270'000 Franken (jeweils zuzüglich 19% Sozialleistungen) – beantragt, mit dem in einem ersten Schritt 20% der Differenz zwischen Ist- und Soll-Lohn gewährt werden könnten. Der Stadtrat beantragt, auch für die Überführung in der Variante
BesArbOl 2 mini dieselbe Summe einzusetzen. Dies erlaubt einen ersten Schritt von 25%, Damit pendelt sich das Lohnsystem rascher ein. Da die Besoldungsrevision Mitte 2008 eingeführt werden soll, reduzieren sich die Überführungskosten im Jahr 2008 unter Berücksichtigung des per 1.1.2008 erfolgenden Stufenanstiegs auf Fr. 122’565.-.
5.1.2 Wiederkehrende Kosten Personal im Jahreslohn
In den Folgejahren steigen die Lohnkosten jeweils um die erwähnten, reglementarisch festgelegten Brutto-Maximalwerte an, von denen Gewinne aus Mutationen und aus Wegfall von Besitzständen abgerechnet werden können. Die schrittweise Anpassung führt dazu, dass über die nächsten 9 Jahre die Lohnkosten im Vergleich zu den aktuellen – unter Berücksichtigung der heutigen, ab 2009 wegfallenden Anerkennungszulage (1% der anrechenbaren Besoldung der berechtigten Personen = ca. Fr. 160'000.- pro Jahr) und der heutigen Systempflege – um netto durchschnittlich rund 2,4% ansteigen werden (und damit weniger als im alten Finanzplan 2006-2011). Aufgrund der Mutationsgewinne pendelt sich das System ab 2018 im Vergleich zu heute bei knapp 4,9% oder Fr. 831’000 Mehrkosten (zuzüglich 19% Sozialleistungen) ein (zum Vergleich: Bei der letzten Besoldungsrevision von 1989/90 betrugen die Mehrkosten rund 6%). Ab 2018 entstehen somit keine Mehrkosten mehr.
Zieht man von diesen Mehrkosten die 1% Reallohnerhöhung, welche die kantonalen Angestellten und damit auch die Lehrpersonen der Stadt Olten Ende 2006 erhielten, und die 0,5% der gesamten Lohnsumme, welche das Parlament Ende 2005 zwar einmalig zurückstellte, die aber somit wiederkehrend wegfielen, ab, ergeben sich Steigerungswerte um durch-schnittlich rund 0,9% bzw. total knapp 3,4%.
5.2 Wiederkehrende Kosten Personal im Stundenlohn und Zulagen
Die Kosten für Lohnanstiege Personal im Stundenlohn (Überführung) betragen rund Fr. 38’000.-, die Mehrkosten für die Anpassungen beim Zulagensystem Fr. 14’000.-, total inkl. 14% Sozialleistungen rund 59'200 Franken.
5.3 Kosten für Höherversicherungen Pensionskasse
Als Einlage sind im Jahr 2008 für die Höherversicherungen Arbeitgeberbeiträge in der Höhe von Fr. 377’330.- an die Pensionskasse zu leisten.
Die Einkaufssumme für die vom Gemeindeparlament an der Budgetsitzung im Dezember 2005 für die Umsetzung der Besoldungsrevision zu Gunsten des städtischen Personals beschlossene Rückstellung in Höhe von 0,5% der gesamten Lohnsumme wird verwendet, um die entsprechenden ebenfalls anfallenden Arbeitnehmerbeiträge durch anteilmässige Beiträge zu entlasten. Dieser Schritt zu Gunsten der neu höher Eingestuften ist gerechtfertigt, da einerseits für diese laut der Neueinstufung – unter Umständen bereits seit einer gewissen Zeitspanne – ein höheres Gehalt gerechtfertigt ist, das ihnen im Übrigen auch jetzt nur zu einem Teil ausgerichtet wird, und anderseits die neu tiefer Eingestuften von der Besitzstandsregelung profitieren können.
6. Realisierung
Anschliessend an den Entscheid des Gemeindeparlaments und die erforderliche Volksab-stimmung (am 24. November 2007) ist vorgesehen, die Lohnberechnungen definitiv vorzunehmen und diese den Mitarbeitenden zu eröffnen. Wie schon nach der Verteilung der Fragebogenprotokolle an alle Mitarbeitenden im Jahreslohn sollen diese daraufhin in Sprechstunden Fragen zum Ergebnis stellen können. Sind sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, haben sie die Möglichkeit einer Einsprache an den Stadtrat. Diese Einsprache kann sich gegen die Einreihung in die vorgesehene Lohnklasse und/oder gegen die individuelle Einstufung im Lohnband richten. Nach dem anschliessenden Stadtratsentscheid besteht ferner die Möglichkeit einer Beschwerde auf dem üblichen Rechtsweg an das zuständige Departement und anschliessend an das Verwaltungsgericht. Parallel dazu erarbeiten der Projektleiter und der Rechtsdienst die auf Grund des neuen Lohnsystems nötigen, bereits im Entwurf vorliegenden Änderungen der Personalverordnung , die dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden.
Da die Mitarbeitenden nach der definitiven Eröffnung der künftigen Lohnklasse und des definitiven künftigen Gehalts die Gelegenheit haben müssen, bis zur Einführung des neuen Lohnsystems fristgerecht zu kündigen und einzelne Mitarbeitende bis zu sechs Monate Kündigungsfrist haben, ist die Einführung des neuen Lohnsystems auf den 1. Juli 2008 geplant. Somit wird es im Falle einer Zustimmung von Parlament und Volk trotz Überarbeitung nur um ein Jahr verzögert gegenüber der Vorlage vom November 2006 in Kraft treten.
7. Stellungnahmen
7.1 Betriebskommission BeKo
Die Betriebskommission betont in ihrer Stellungnahme , sie sei sich darüber im Klaren, dass es sich bei dieser Vorlage um eine Kompromisslösung handle, nachdem die erste Vorlage zurückgezogen werden musste. Es bestünden deshalb auch einige Vorbehalte ihrerseits; insbesondere stelle sich die Frage, ob das System Abakaba so noch stimme. Kritisiert werden in der Stellungnahme unter anderem die Neudefinition der Führungsmerkmale, die Begrenzung der Ausschläge von Mehr- und Minderlohnanwartschaften sowie einzelne Zulagenregelungen. Zudem wird ein Teuerungsausgleich nach Landesindex befürwortet.
7.2 Personalverbände
Die Personalverbände PSO, VSPB und vpod betonen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme , während sie sich hinter der Vorlage BesArbOl 1 vom November 2006 hätten stellen können, da es sich um die Umsetzung einer analytischen Arbeitsbewertung gehandelt habe, könnten sie hinter der überarbeiteten Vorlage weder in formeller noch in materieller Hinsicht stehen. Stossend sei, dass die mit der Materie vertraute Arbeitsgruppe nicht mehr beigezogen worden sei. Während die Neudefinition des Führungsmerkmals den Personalverbänden nachvollziehbar erscheint, erteilen sie der Begrenzung der Ausschläge von Mehr- oder Minderlohnanwartschaften eine klare Absage, da sie zu einer Verzerrung des internen Lohngefüges führe. Sie fordern daher eine Streichung dieser Massnahme. Bei der Überführung rufen sie nach einer Besitzstandesgarantie auch für die Zulagen sowie einer Fortsetzung des ersten Schritts von 25% der Differenz zwischen Ist- und Soll-Lohn auch in den folgenden Jahren nach 2008. Auch sie befürworten einen Teuerungsausgleich nach Landesindex und begrüssen die angestrebte Entkoppelung von Besoldungsrevision und Neuausrichtung der Familienzulage.
7.3 Stabsstellen
7.3.1 Personaldienst
Der Personaldienst führt aus, die Projektgruppe Besarbol habe sich seit Januar 2005 mit dem neuen analytischen Besoldungsmodell ABAKABA befasst. Mit Hilfe des externen Experten Christian Katz seien die verschiedenen Funktionen analytisch erfasst worden. Es sei eine Vernehmlassung bei den Vorgesetzten und den Mitarbeitenden gefolgt. Der nun vorliegende Entwurf sei seriös erarbeitet worden, breit abgestützt und verdiene deshalb aus Sicht des Personaldienstes Unterstützung.
7.3.2 Controlling
Bei der überarbeiteten Vorlage wurden sämtliche Grundelemente des BesArbOl 1-Systems belassen. Um jedoch die Einsparungskriterien gemäss Auftrag des Gemeindeparlaments erreichen zu können, mussten – wie in der Vorlage erläutert – zusätzliche System-Parameter gesetzt werden. Diese sind unabdingbar und als Einheit zu verstehen, weil sonst das Kostenziel nicht erreicht wird bzw. das System nicht mehr funktioniert.
Die finanziellen Auswirkungen sind im Kapitel 5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgezeigt. Die entstehenden Mehrkosten sind im aktuellen Finanzplan enthalten.
Die EGO wird mit der vorgeschlagenen Besoldungsrevision grundsätzlich auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähiger. Allerdings ist die Lohnentwicklung z. B. beim Staatspersonal aktuell deutlich höher, da dieses nebst den im Kapitel 5.1.2 erwähnten Lohnunterschieden von
1.5 % noch zusätzlich die individuellen jährlichen Lohnanpassungen erhält.
7.3.3 Rechtsdienst
Der Rechtsdienst führt aus, mit dem vorliegenden Bericht und Antrag würden auch die nötigen reglementarischen Grundlagen für die Besoldungsrevision geschaffen (Teilrevision Art. 22ff. Personalreglement). Mit der Eingliederung des neuen Besoldungskonzepts in das Personalreglement könnten auch die noch verbliebenen, in Kraft stehenden Bestimmungen der AGO (bisher im Anhang 2 zur Personalverordnung aufgeführt; vgl. dazu Art. 18 PV) aufgehoben werden, was der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit dieser Bestimmungen sicherlich dienlich sei. Die Vollzugs- und Überführungsbestimmungen würden im Detail in der Personalverordnung durch den Stadtrat geregelt, welche in einem Entwurf bereits vorliege.
Aufgrund der finanziellen Folgen der Besoldungsrevision unterstehe dieser Beschluss dem obligatorischen Referendum (Art. 13 lit. c der Gemeindeordnung: jährlich wiederkehrende Kosten von über Fr. 400'000.00).
Im übrigen schliesst sich der Rechtsdienst der Stellungnahme der Direktionskonferenz an.
7.4 Direktionskonferenz
Die Mitglieder der Direktionskonferenz beurteilten an ihrer Sitzung vom 6. Juli 2007 die auf Grund der Reaktionen von Seiten des Gemeindeparlaments und der Fraktionen erarbeitete Kompromiss-Vorlage als gangbaren Weg, damit das Personal ohne weitere Verzögerung von den Vorteilen der Besoldungsrevision profitieren kann. Sie unterstützen deshalb den vorliegenden Bericht und Antrag. Sie geben ferner zu bedenken, dass im Sinne einer Gleichbehandlung mit dem Staatspersonal und der von den gleichen Regelungen profitierenden Lehrerschaft auch dem städtischen Personal der Teuerungsausgleich gemäss Index gewährt werden sollte. Zumal das städtische Personal schon bei vergangenen wie auch geplanten Reallohnerhöhungen für die kantonalen Angestellten (2007: +1,0%; 2008: gefordert +2,5%) ins Hintertreffen geraten ist bzw. gerät.
7.5 Fazit des Stadtrates zu den Stellungnahmen
Der Stadtrat hält im Wesentlichen an seiner Vorlage fest. Zur Frage eines weiteren Einbezugs der Begleitgruppe erklärt er, dass deren Mitglieder zwar auf verschiedenen Kanälen auf dem Laufenden gehalten wurden, dass ihre Wiedereinberufung indessen nicht notwendig war, da mit Ausnahme der vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Überprüfung des Führungsmerkmals nicht die ermittelten Abakaba-Punktwerte verändert wurden, sondern – vom Stadtrat auf Grund der Reaktionen im Parlament angeordnet – reine Massnahmen zur Kostensenkung erfolgten. Der externe Abakaba-Experte der ersten Phase wurde für die Neudefinition des Führungsmerkmals einbezogen und auch die übrigen Änderungsabsichten wurden mit ihm besprochen. Richtig ist, dass die nun vorliegende Version einen Kompromiss zwischen dem heutigen Lohnsystem und der Vorlage vom November 2006 darstellt; angesichts des Sparauftrags des Parlaments kann indessen die erste Vorlage nicht als absolute Grösse herangezogen und somit auch nicht von Benachteiligung und „Bestrafung“ gesprochen werden, kommen doch eine grosse Anzahl von Mitarbeitenden auch mit dem System BesArbOl 2 mini in den Genuss eines erhöhten Lohnes, was – wie auch das Controlling feststellt – die Konkurrenzfähigkeit des Arbeitgebers Stadtverwaltung Olten verbessern würde. Angesichts der immer noch in Aussicht stehenden Mehrkosten kann auch nicht davon gesprochen werden, dass das städtische Personal nur „Brösmeli“ erhalten solle; der schwergewichtig auf (ausserordentliche) Steuererträge zurückzuführende Rechnungsabschluss 2006 ist hier nicht relevant.
Zu einzelnen Punkten:
„Erben“ von Positionen: Davon sind die Besitzstandsfunktionen ganz klar nicht betroffen; hier fand offenbar eine Verwechslung mit dem Vorgehen zur Erstellung des neuen Einreihungsplans im Rahmen des Systems BesArbOl 2 mini statt.
Änderung Einreihungsplan durch Neudefinition Führungsmerkmal: Die Änderungen sind auf Grund der neuen Punktzahlen transparent und ohne Bevorzugung oder Benachteiligung von einzelnen Funktionen, Personen oder entsprechenden Direktionen erfolgt.
BesArbOl 2 mini: Wie erwähnt stellt dieses System einen Kompromiss aus Kostengründen zwischen dem bisherigen und dem im November mangels breiter politischer Unterstützung zurückgezogenen System BesArbOl 1 dar. Da das Vorgehen, das heisst die „Umrechnung“, für alle Mitarbeitenden einheitlich ist, ist der Vorwurf der Willkür haltlos. Dem Argument der „Verzerrung“ muss entgegengehalten werden, dass beispielsweise in den unteren 14 Lohnklassen keine Verschiebungen auf Grund von BesArbOl 2 mini von Funktionen in andere Lohnklassen erfolgen.
Einreihungskompetenz: Die Zuordnung neuer Funktionen oder die Neuzuordnung bestehender Funktionen basiert auf der Bewertung mit Abakaba als Empfehlung. Im Sinne der internen Gleichbehandlung müssen aber auch diese Funktionen mit dem aus dem System BesArbOl 2 mini resultierenden Einreihungsplan in Einklang gebracht werden. Die vollumfängliche Kompetenz dafür liegt beim Stadtrat.
Bewertungskommission: Die Inanspruchnahme einer vom Stadtrat eingesetzten paritätisch zusammengesetzten Bewertungskommission für Neubewertungen erscheint dem Stadtrat als unverhältnismässig und nicht praktikabel; die Ausarbeitung der entsprechenden Anträge zu Handen des Stadtrates obliegt der zuständigen Direktion in Zusammenarbeit mit dem Personaldienst.
Überführung: Bei allen Mitarbeitenden stellen die Zulagen, die in einzelnen Fällen (Winterdienst im Werkhof) im Übrigen stark variieren können, keinen Bestandteil der Besitzstandsgarantie dar. Aus Kostengründen kann ferner der erste Schritt von 25% der Differenz zwischen Ist- und Soll-Lohn per 1.7.2008 nicht jährlich wiederholt werden (was im Übrigen auch nicht in der Version BesArbOl 1 vorgesehen war); die Weiterentwicklung des Lohnes ist von der Leistungskomponente abhängig und kann von den betroffenen Personen somit beeinflusst werden.
Mitarbeiterbeurteilung: Der Antrag, eine „Rekursmöglichkeit“ innerhalb der Verwaltung zu schaffen, wurde aufgenommen.
Austrittsgratifikation: Der Antrag, die bisherige Regelung beizubehalten, wurde aufgenommen.
8. Abschreibung eines hängigen Vorstosses
Aufgrund der beantragten Massnahmen kann folgender Vorstoss abgeschrieben werden:
Postulat Beat Moser und Mitunterzeichnende der FdP-Fraktion betr. Richtlinien über die Ausrichtung der Anerkennungszulage
Der Stadtrat wird aufgefordert, die „Richtlinien über die Ausrichtung der Anerkennungszulage“ vom 1. September 1992 zu überarbeiten und eine neue, zusätzliche Anleitung für die „Bewertung der Leistung eines Angestellten zur Ausrichtung der Anerkennungszulage“ zu erstellen.
9. Beschlussesanträge:
9.1 Die Besoldungsrevision wird im Sinne der Erwägungen bewilligt und auf 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt.
9.2 Die Teilrevision des Personalreglements gemäss Anhang wird genehmigt. Sie tritt nach Genehmigung durch den Regierungsrat per 1. Juli 2008 in Kraft.
9.3 Der Stadtrat wird beauftragt, innert 3 Jahren dem Gemeindeparlament eine Vorlage für eine Neuausrichtung der Familienzulage zu unterbreiten, deren Gesamtkosten diejenige der heutigen Familienzulage nicht überschreiten dürfen.
9.4 Das Postulat Beat Moser und Mitunterzeichnende der FdP-Fraktion betr. Richtlinien über die Ausrichtung der Anerkennungszulage wird abgeschrieben.
9.5 Mit dem Vollzug wird der Stadtrat beauftragt.
9.6 Ziff. 9.1 und 9.2 dieses Beschlusses unterliegen dem obligatorischen Referendum.
Beilagen:
1 Synoptische Darstellung Stellungnahmen der Fraktionen nach Vorinformation vom 10. April 2007
2 Neues Lohnsystem Stadtverwaltung Olten (BesArbOl 2 mini)
3 Synoptische Darstellung Teilrevision Art. 22 Personalreglement
4 Synoptische Darstellung Teilrevision Personalverordnung (Entwurf)
5 Lohnvergleiche
- Olten/Zofingen/Aarau/Burgdorf
- BDO Visura
- Zentralverband Staats- und Gemeindepersonal Schweiz 2005/2006 / SKV / BASS / vpod / AWA Aargau
6 Auswirkungen Besoldungsrevision auf Planjahre 2008-2018
7 Stellungnahme Betriebskommission
8 Stellungnahme PSO, VSPB, vpod
Olten, 20. August 2007
NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber:
Ernst Zingg Markus Dietler